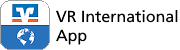500 Mrd. Euro: Das Infrastrukturpaket der neuen Bundesregierung
Das Programm soll die strukturellen Schwächen der deutschen Volkswirtschaft ebenso wie die Herausforderungen der kommenden Jahre adressieren.

Nun hat es doch geklappt: Friedrich Merz ist im zweiten Anlauf zum Bundeskanzler gewählt worden. Und auch die neuen Ministerinnen und Minister stehen fest. Doch bereits im März hatte der nun alte Bundestag mit dem Beschluss eines 500 Mrd. Euro schweren Infrastruktur-Sondervermögens ein klares wirtschaftspolitisches Signal gesetzt. Das auf zwölf Jahre angelegte Programm bricht mit fiskalpolitischen Dogmen der letzten Dekaden und markiert eine Kehrtwende in der Ausgabenpolitik des Bundes. Das Ziel dabei ist klar: Deutschland wieder wettbewerbsfähig(er) zu machen. Mithilfe des Infrastrukturpakets soll die physische und digitale Infrastruktur modernisiert, der Klimaschutz sowie Bildung und Forschung gefördert werden.
Kritik am Sondervermögen ließ nicht lange auf sich warten. Insbesondere ein immenser Anstieg der Staatsverschuldung und ein möglicherweise zunehmender Preisdruck wurden angemahnt. Ein genauerer Blick auf das verabschiedete Gesetz zum Sondervermögen legt zwei Erkenntnisse nahe. Zum einen führt die langfristige Ausrichtung des Programms dazu, dass in der Wirtschaft Kapazitäten aufgebaut werden, was einem nachhaltigen Inflationsanstieg entgegenwirken dürfte. Zum anderen wird die deutsche Staatschuldenquote zwar ansteigen. Ausgehend von derzeit etwas über 60% sollte die Marke von 80% selbst unter konservativen Annahmen für das BIP-Wachstum in den nächsten Jahren jedoch nicht überschritten werden. Damit läge die Quote weiterhin klar unter dem EWU-Durchschnitt (89%).
Das Sondervermögen dürfte sich nicht nur auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, sondern insbesondere auch auf zentrale Sektoren positiv auswirken. Im Fokus dürften dabei ausgewählte Branchen stehen – vom Bau über Industrie und Energie bis hin zu Technologie und Bankenwesen. In diesen Sektoren wird sich zeigen, ob das Paket mehr als ein fiskalpolitisches Signal ist und tatsächlich als nachhaltiger Katalysator für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit fungieren kann.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden sowohl im In- als auch im Ausland deutsche Bundesregierungen vielfach mit dem Vorwurf konfrontiert, zu wenig zu investieren. So hat das Vorhaben das Potenzial, einige der Versäumnisse aus dieser Zeit wettzumachen. Dabei wird entscheidend sein, dass flankierende Maßnahmen getroffen werden, die das Planungsverfahren und den Abbau überflüssiger Bürokratie ermöglichen. Denn allein das Geld reicht nicht, um Deutschland auf den richtigen Wachstumspfad zurückzuführen.
Bei all der teils berechtigten und teils auch überzogenen Skepsis überwiegt aber derzeit insgesamt die positive Erwartungshaltung. Auch der Kapitalmarkt reagierte auf den Beschluss mit Zuversicht (vor Trumps „Liberation Day“). Der Euro gewann an Stärke, deutsche und europäische Aktienindizes legten zu. Das Signal an die Investoren ist da. Deutschland scheint entschlossen, seine Infrastruktur zu modernisieren und damit das Fundament für langfristiges Wachstum sowie wirtschaftliche Stabilität zu legen.
Zu diesem Thema gibt es auch eine Podcast-Folge des DZ Research auf Spotify und Apple Podcasts.
-- Thomas Kulp