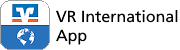Reform des Emissionshandels – Chancen und Herausforderungen für Wirtschaft und Politik
Der CO2-Preis soll ab 2027 frei am Markt gebildet werden. Ohne politische Vorbereitung und weitere Klimaschutzmaßnahmen droht ein spürbarer Preissprung bei Energie.

Im Jahr 2023 wurde im Rahmen des EU-Klimapakets „Fit for 55“ eine umfassende Reform des Europäischen Emissionshandelssystems (ETS) beschlossen, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Diese Reform umfasst mehrere Kernelemente, die darauf abzielen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu sichern. Dazu gehört die Verschärfung der Emissionsobergrenze und die Einführung eines Grenzausgleichsmechanismus zum Schutz der heimischen Industrie vor Konkurrenz aus Nicht-EU-Ländern. Zudem wurde ein Klima-Sozialfonds eingerichtet, um die sozialen Folgen steigender CO2-Preise abzufedern. Nicht zuletzt wird ab 2027 ein neues, separates Emissionshandelssystem für die Sektoren Gebäude und Straßenverkehr eingeführt (ETS 2).
In Deutschland besteht seit 2021 ein nationales Emissionshandelssystem für die Sektoren Wärmeerzeugung, Verkehr und Abfall. Dieses soll 2027 in das ETS 2 integriert werden. Um den Übergang zu erleichtern, gelten bis 2026 feste CO2-Preise bzw. Preiskorridore, die jährlich ansteigen. Mit der Integration in das ETS 2 ab 2027 wird sich der Preis jedoch frei am Markt bilden. Experten erwarten dadurch einen deutlichen Preissprung – möglicherweise auf 100 bis 300 EUR pro Tonne, ausgehend von 55 bis 65 EUR Ende nächsten Jahres.
Ob und inwieweit diese Befürchtungen zutreffen, hängt maßgeblich von politischen Entscheidungen und dem Fortschritt der umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen ab. Allerdings hinkt die Energiewende in Deutschland hinterher. Ohne gezielte Maßnahmen der Regierung könnten Kraft- und Heizstoffe deutlich teurer werden, was vor allem einkommensschwache Haushalte und Kleinstunternehmen stark belasten würde. Um die Preissteigerungen abzufedern, sollten die Mittel aus dem Klima-Sozialfonds und dem nationalen Klima- und Transformationsfonds genutzt werden.
Das EU-Emissionshandelssystem bietet einerseits die Möglichkeit, Emissionen gezielt zu kontrollieren und innovative Lösungen zu fördern, birgt aber auch Risiken wie starke Preisschwankungen und Nachteile für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das System schafft Anreize für nachhaltigere Technologien und Prozesse, dürfte aber auch zu einer Verteuerung von Gütern in der EU führen und den Inflationsdruck erhöhen. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern, sind nationale und europäische Maßnahmen erforderlich, wie staatliche Förderungen, die Senkung der Stromsteuer und die Einführung des Klimageldes. Nicht zuletzt sollte auch die Infrastruktur durch gezielte Investitionen in den öffentlichen Verkehr und die energetische Sanierung gestärkt werden.
-- Linda Yu