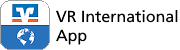Sondervermögen, Ausnahme Schuldenbremse – wohin führt das?
Europa eilt von Sondergipfel zu Sondergipfel, und in Deutschland gibt es wenige Tage nach den Wahlen noch keine handlungsfähige Regierung. Die wohl kommende schwarz-rote Koalition ist gezwungen, ihre Verhandlungen unter enormen Zeitdruck zu führen.
Wie verlautet, sollen zur Finanzierung der notwendigen zusätzlichen Ausgaben besonders im Bereich der Verteidigung sowohl eine Veränderung der Schuldenbremse vorgenommen als auch ein neues Sondervermögen aufgelegt werden. Die Rede ist von einem Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen im Umfang von 500 Mrd. Euro und von einer Öffnung der Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben (>1% des BIP). Diese Beschlüsse sollen bereits in der kommenden Woche vom noch im Amt befindlichen „alten“ Bundestag gefasst werden.
Welche Effekte für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wären davon zu erwarten? Das Sondervermögen von 500 Mrd. Euro ist auf zehn Jahre ausgelegt, entspräche demnach einer zusätzlichen Investitionssumme von rund 1,2% des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Jahr. Bei den Verteidigungsausgaben ist von einer kräftigen Erhöhung auf mindestens 3% des BIP auszugehen. In diesem Fall wären also zusätzliche Ausgaben von rund 2% des BIP über Kredite zu finanzieren.
Wie hoch der Anstieg der Staatsausgaben in den kommenden Jahren tatsächlich per Saldo ausfällt, hängt natürlich auch davon ab, ob man sich in den Verhandlungen noch zu Einsparungen an anderer Stelle durchringen kann. Erfahrungsgemäß fällt eine Einigung in diesem Bereich wesentlich schwerer.
Für die konjunkturellen Effekte wäre entscheidend, wie schnell die neuen Kreditmittel zum Einsatz gebracht werden können. Bei den Verteidigungsausgaben ist die internationale Koordination mit den Partnerländern und das Identifizieren des dringendsten Bedarfs entscheidend, bei den zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen ist eine Beschleunigung der Planungsprozesse, aber auch die Sicherstellung einer effizienten Mittelverwendung wichtig. Nach einer „Aufgleisungsphase“ ist also von einem zusätzlichen Investitionsvolumen von etwa 2-3% des BIP pro Jahr auszugehen, verglichen mit dem Jahr 2024. Angesichts einer schon länger stagnierenden deutschen Wirtschaft würde dies einen erheblichen Schub bedeuten. Die Wirtschaftsleistung wird über mehrere Jahre kräftiger zulegen, bis der neue, höhere Ausgabenpfad erreicht ist.
Auch in den anderen Ländern Europas werden die Militärausgaben kräftig ansteigen (müssen). Die EU-Kommission hat angekündigt, dafür die Schuldenregeln des Maastrichtvertrages außer Kraft zu setzen. Damit wird die öffentliche Verschuldung am Kapitalmarkt merklich ausgeweitet werden. Renditesteigerungen bei Staatsanleihen dürften die Folge sein.
Die kräftigere Konjunktur könnte auch zu einem lohn- und nachfragebedingten Inflationsanstieg führen, nach dem Muster der durch die Corona-Hilfsfonds nach oben getriebenen US-Inflation 2021/2022. Dieses Risiko könnte die EZB schon in diesem Frühjahr dazu veranlassen, die Zinsen weniger stark zu senken als bislang vermutet. Das veränderte transatlantische Zinsbild wiederum würde dem Euro gegenüber dem US-Dollar Auftrieb geben.
Die Aktienmärkte spielen nach unserer Einschätzung schon seit der Wahl den Gedanken eines erhöhten deficit spending. Sollten nun gleich zwei „Sondertöpfe“ im derzeit diskutierten Ausmaß Realität werden, hätten Aktien wohl erhebliches weiteres Anstiegspotenzial, auch abseits der Rüstungsindustrie. Alles in allem dürften sich durch die anstehenden Entscheidungen in der europäischen Sicherheitspolitik sowie die Beschlüsse der kommenden Bundesregierung also ganz erhebliche Auswirkungen auf Konjunktur und Kapitalmärkte ergeben.
-- Dr. Michael Holstein