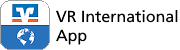ESG: Vom In-Wort zum Unwort
Sowohl in den USA als auch in Europa haben die Widerstände in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit zuletzt zugenommen. Doch während die Debatte in den USA insbesondere ideologisch motiviert ist, erwächst der Gegenwind in Europa eher aus „ökonomischen Zwängen“.
ESG-Konzepte sind eines der bestimmenden Themen der letzten Jahre an den Finanzmärkten gewesen. Mittlerweile nimmt der politische Gegenwind bei ESG-Themen aber merklich zu. Dies gilt speziell für die USA: Noch bevor Donald Trump erneut als Präsident vereidigt wurde und den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt gab, kündigten große US-Banken und Vermögensverwalter ebenso wie die US-Zentralbank ihren Rückzug aus den jeweiligen globalen Klimaallianzen an. Die Geschehnisse sind im Kontext eines ideologischen Konfliktes zu sehen, welcher speziell auch den Begriff ESG – bei aller vortragbaren konstruktiven Kritik – in manchen Kreisen der USA zu einem Unwort gemacht hat. Seit einiger Zeit existiert sogar der Ausdruck Greenhushing. Damit ist das bewusste Kleinreden oder Verschweigen von sozialem oder ökologischem Engagement gemeint, um mit eben diesem Engagement nicht politisch anzuecken. Unabhängig davon, dass sich die Auswirkungen der genannten Austritte nicht exakt abschätzen lassen, ist die davon ausgehende Signalwirkung negativ zu beurteilen.
In Europa haben die Widerstände gegen das Thema ESG zwar ebenfalls zugenommen, allerdings gibt es einen Unterschied in der Motivation: Während in den USA der Faktor Ideologie zentral ist, stehen in Europa wirtschaftspolitische Beweggründe im Vordergrund. Das dürftige Wachstum in weiten Teilen der EU macht – unter dem Stichwort ‚Mehr Wettbewerbsfähigkeit‘ – Rufe nach einer Entlastung der Unternehmen von Bürokratie laut, zumal die USA zeitgleich in eine Phase der Deregulierung einzutreten scheinen. Vor diesem Hintergrund sind zuletzt gerade aus Frankreich und Deutschland Forderungen geäußert geworden, die mit umfangreichen Berichtspflichten verbundene Nachhaltigkeitsregulierung zu lockern. Ende Februar sollen hierzu mehr Details bekanntgegeben werden. Eine grundlegende Abkehr von den Zielen des EU-Aktionsplanes zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums oder des European Green Deal ist bislang aber nicht zu erkennen.
Dies wäre auch nicht ratsam. Denn das Erkennen und Eindämmen der mit dem Klimawandel einhergehenden Risiken und Probleme muss eine Triebfeder für die Auseinandersetzung mit ESG-Inhalten bleiben und sollte angesichts steigender klimabezogener Schäden schon aus strategischer Sorgfaltspflicht zum Repertoire der Finanzindustrie zählen.
-- Tobias Gruber, Torsten Hähn